Psychologische Erklärungsmodelle für Motive und Motivation
Begriffsklärungen
Allen frühen Motivationskonzepten ist gemeinsam, dass sie den Schlüssel zum Verhalten in der Biologie des Menschen suchen und mehr oder weniger lange Listen mit angeborenen Trieben oder Instinkten erstellten, die jegliches menschliche Verhalten erklären sollten. Die Erklärungsansätze der wissenschaftlichen Psychologie für Motivation lassen sich dabei grob in zwei große Gruppen aufteilen:
- Die einen sehen den Menschen als Getriebenen, der von Instinkten, Hormonen, äußeren Reizen oder Trieben bestimmt wird und dessen Handeln damit immer auch etwas Zwangsläufiges hat.
- Die anderen betonen die Handlungsfähigkeit und damit die Freiheit des Subjekts, sich selbst immer neu zu entwerfen und in die Zukunft zu projizieren.
Beide Grundpositionen bestehen bis heute, weil wohl beide ihre Meriten haben, denn bestimmte Aspekte menschlichen Verhaltens, Wollens und Wünschens lassen sich eben mit dem einen Ansatz besser erklären, andere Aspekte mit dem anderen.
Allgemein ausgedrückt sind Motive in der Psychologie richtunggebende, leitende und antreibende psychische Ursachen des Handelns. Motive befähigen ihren Besitzer, bestimmte Gegenstände wahrzunehmen und durch die Wahrnehmung eine emotionale Erregung zu erleben, daraufhin in bestimmter Weise zu handeln oder wenigstens den Impuls zur Handlung zu verspüren. Man unterscheidet
- biogene oder primäre Motive diese sind angeboren, haben eine genetische Grundlage und eine phylogenetische Entwicklung. Es gilt heute als sicher, dass auch angeborene Motive durch Umwelteinflüsse überlagert und ausgestaltet werden, und
- soziogene oder sekundäre Motive die gelernt bzw. erworben werden. Für deren individualspezifische Ausprägung sind besonders die Einflüsse während der ersten Lebensjahre entscheidend.
Beide Motivarten wirken meist zusammen, etwa beim Hunger, der zwar vorwiegend biogen ist, soziogen jedoch, wenn er gegen die Mittagszeit auftritt. Die grundlegenden Motive sind vital bedeutungshaltige, universelle Anliegen, sie sind Antworten auf die fundamentalen Probleme des Überlebens und der Fortpflanzung. Die meisten Motive sind daher beim Menschen universell und überkulturell, aber die meisten treten nicht nur beim Menschen sondern auch bei Säugetieren auf. Beim Menschen nimmt man an, dass Motive nur relativ grob umfasste Verhaltensprogramme sind, die durch die jeweilige Kultur überformt (sozialisiert) werden, wobei der kulturelle Wandel auch das Hervorbringen immer neuer Motive bewirkt. Dass diese auf Grund ihrer "Herkunft" meist Uminterpretationen darstellen, soll hier explizit erwähnt werden.
Motivation ist der Zustand des Motiviertseins und stellt die Gesamtheit aller in einer Handlung wirksamen Motive dar, die das Verhalten des Individuums aktivieren und regulieren. Unter Motivation versteht man also die Bereitschaft, in einer konkreten Situation eine bestimmte Handlung mit einer bestimmten Intensität bzw. Dauerhaftigkeit auszuführen (z.B. konzentrierte Auseinandersetzung mit den Inhalten eines Lehrbuches). Man unterscheidet zwei Formen von Motivation, wobei diese schon von Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik beschrieben wurden (siehe unten):
- intrinsische Motivation Die Ausführung der Handlung ist aus sich heraus Belohnung genug (z.B. Neugier, Spaß, Interesse) und
- extrinsische Motivation An die Ausführung der Handlung sind äußerliche Belohnungen geknüpft (z.B. Lob, gute Note, Schein) bzw. an die Nicht-Ausführung der Handlung sind Bestrafungen geknüpft (z.B. Tadel, schlechte Note, keine Scheinvergabe).
Die intrinsische Motivation setzt sich demnach zusammen aus dem Sachinteresse (Neugier), dem Anreiz (positive Emotion) und der Erfolgserwartung.
Intrinsisches Verhalten ist also jenes Verhalten, das Zweck an sich selbst ist bzw. sich selbst zum Zweck hat, also "autotelisch" ist. Nach White (1959) liegt diesem Verhalten ein "Gefühl der Wirksamkeit" zu Grunde. Autotelisches Verhalten findet sich besonders bei Kleinkindern: Ein Kind, das Freude daran hat, mit Baussteinen einen Turm zu bauen und diesen wieder einstürzen zu lassen, verbindet damit noch keinen weitergehenden Zweck. Es geht völlig auf im staunenden Erleben und in der Funktionslust auf. Beim Erwachsenen sind solche Verhaltensweisen seltener zu finden, oft iin Form kurzweiliger Aktivitäten, wie dem Spiel oder dem ästhetischen Erleben. Nach Csikszentmihalyi (1975) bedeutet intrinsich die freie Hingabe an eine Sache, ein völliges Absorbiertwerden des Erlebens von der voranschreitenden Handlung, dem "Flow-Erlebnis". Das Flow-Erleben benötigt bestimmte Bedingungen: so muß die Aufgabenschwierigkeit die eigene Tüchtigkeit voll herausfordern. Zu leichte Aufgaben führen zu Langeweile, zu anspruchsvolle rufen Angst hervor. Jedenfalls entspricht diese Bedingung dem Anspruchsniveau Erfolgsorientierter; sie maximiert die internale Ursachenlokation für erzielte Handlungsergebnisse. Flow-Erleben bringt den Unterschied zwischen Arbeit und Spiel zum Verschwinden. Nach Heckhausen (1977) ist eine Motivatio intrinsisch, wenn Mittel (Handlung) und Zweck (Handlungsziel) thematisch übereinstimmen, also gleichthematisch sind. Leistungshandeln ist demnach dann intrinsisch, wenn es nur um des zu erzielenden Leistungsergebnisses willen unternommen wird, also bloß um den Zweck der Erprobung an einer bestimmten Aufgabe, um damit die eigene Tüchtigkeit einer Selbstbewertung zu unterziehen.
Die extrinsische Motivation besteht somit lediglich aus der positiven Verstärkung (Belohnung) oder der negativen Verstärkung (Zwang).
Anreize sind situative Anregungen, d.h., ihre Wirksamkeit ergibt sich aus ihrer natürlichen oder sozialen Werthaftigkeit. Objektive Sachverhalte sind Umweltanreize, während subjektive Sachverhalte die von einer Person wahrgenommenen Anreize sind. Nur letztere sind handlungswirksam. Anreize und Motive sind wechselseitig voneinander abhängig, denn ein Motiv kann nur in dem Ausmaß verhaltenswirksam werden, wie es durch situative Anreize angeregt wird. Andererseits kann auch ein Anreiz nur in dem Ausmaß verhaltenswirksam werden, wenn er auf die entsprechenden Wertungsdispositionen im Individuum treffen.
Emotionen spielen bei Motiven oft eine wichtige Rolle, denn Lebewesen wiederholen Handlungen, bei denen sie Lust empfunden haben und vermeiden solche, bei denen Unlust auftritt. Es wurden im Zentralnervensystem Strukturen nachgewiesen, deren Aktivierung Lust oder Unlust bewirken. Motive haben also ein nervöses Korrelat.
Kognitionen spielen insofern eine Rolle, da sie über wahrgenommene Realisierungschancen ebenfalls das Verhalten beeinflussen. Lebewesen lassen sich also nicht ausschließlich von Motiven leiten, sondern rechnen fördernde und hemmende Umstände mit ein.
Die Erwartungs x Wert-Theorie behauptet, dssß Verhalten aus einer meist multiplikative angenommenen Interaktion von Wert und Erwartung erklärbar ist. Diese Größen müssen nicht bewußt sein.
Die Intensität eines Motivs in einem konkreten Einzelfall setzt sich über eine Grundmotivation hinaus aus zwei weiteren Faktoren zusammen: Den Erfolgsaussichten und dem subjektiven Wert eines Ziels.
So mag beispielsweise, gegeben eine erhebliche Ehrgeiz-Grundmotivation, der subjektive Wert eines Nobelpreises für mich sehr hoch sein; dennoch ist meine Motivation, nach ihm zu streben, gering, wenn ich meine Erfolgsaussichten als verschwindend klein einstufe. Umgekehrt kann ich die Erfolgsaussichten des Unternehmens, die Seiten 45 bis 50 des Linzer Telefonbuchs komplett auswendig zu lernen, durchaus als hoch einstufen und bin dennoch kaum motiviert, das zu versuchen, weil der subjektive Wert einer solchen Tat zu nahe bei Null liegt.
Eine Analyse der empirischen Literatur zu Frage der Aufgabenschwierigkeit von Marion Kloep zeigt übrigens eine klare Überlegenheit niedriger Schwierigkeitsgrade vor anderen im Hinblick auf Affekt, Aufgabenwahl, Anstrengung, Ausdauer und Leistung. Sie moniert in ihrer Arbeit auch die eher fragwürdige Forschungs- und Veroffentlichungspraxis vieler Leistungsmotivationsforscher, denen sie vorwirft, mit methodischem Dilettantismus, ungenauer Arbeit und Datenverfälschung bis an die Grenzen wissenschaftlicher Ethik zu gehen.Intrinsisch vs extrinsisch bei viralen Aktionen
Warum manche virale Aktionen wie die Ice Bucket Challenge im Jahr 2014 (Spendensammlung für die Erforschung der Amyotrophen Lateralsklerose) schnell verpuffen, hat van der Linden (2017) mit dem Gegensatz zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation erklärt. Seiner Einschätzung nach misslingt der nachhaltige Transfer vom Klick-Aktionismus in die reale Welt dann, wenn solche Bewegungen nur auf die oberflächliche extrinsische Motivation setzen, wo es nur mehr darum geht, eine Herausforderung anzunehmen, einen Wettbewerb zu gewinnen oder zu mehr Seitenaufrufen beizutragen. Bei der intrinsischen Motivation handeln Menschen jedoch aus inneren Überzeugungen, die bei der Neuauflage 2015 bei den Teilnehmern der Eiskübel-Aktion in weiten Teilen fehlte, denn jeder Vierte präsentierte seinen nassen Oberkörper, ohne das Anliegen der Spendensammlung auch nur mehr zu erwähnen und nur zwanzig Prozent sagten im Video überhaupt eine Spende zu. Mehr Erfolg versprechen daher nur wiederkehrende Aktionen, die es den Teilnehmern ermöglichen, sich als Teil einer sozialen Bewegung zu begreifen, also intrinsisch motiviert handeln. uch der subjektive Wert des Ziels, eine Firmenabteilung mit über hundert Mitarbeitern zu leiten, hoch sein und dennoch die Motivation gering, es anzustreben, weil die Grundmotivation zur Machtausübung klein ist.
Literatur
van der Linden, S. (2017). The nature of viral altruism and how to make it stick. Nature Human Behaviour, dos: 10.1038/s41562-016-0041.
Implizite und explizite Motive
Überdauernde individuelle Motivdispositionen bezeichnet man als implizite Motive, die meist in der frühen Kindheit gelernt wurden und emotional getönte Präferenzen bzw. habituelle Bereitschaften darstellen, sich immer wieder mit bestimmten Arten von Anreizen auseinanderzusetzen. Im Unterschied zu impliziten Motiven sind explizite Motive bewusste, sprachlich repräsentierte oder zumindest repräsentierbare Selbstbilder, Werte und Ziele, die sich eine Person selbst zuschreibt.
Implizite und explizite Motive stimmen nicht immer überein, denn der Einzelne kann von sich selbst und den eigenen Beweggründen Vorstellungen haben, die mit den eigenen unbewussten Präferenzen und habituellen Gewohnheiten nicht übereinstimmen. Im günstigen Fall arbeiten implizite und explizite Motive zusammen, indem die impliziten Motive in spezifische und den situativen Gelegenheiten angepasste Zielsetzungen umgesetzt werden. Häufig stehen aber implizite und explizite Motive mit höchst ungünstigen Folgen für die Handlungseffizienz und für das Wohlbefinden bzw. die psychische Gesundheit im Konflikt (Heckhausen & Heckhausen, 2006). Man weiß daher, dass eine große Diskrepanz zwischen dem, was man sich zuschreibt, und dem, wie man tatsächlich ist, zu einer hohen Anfälligkeit für psychische Krankheiten führt.
Viele Menschen verfolgen daher in ihrem Leben auch Ziele, die sie emotional als völlig unbefriedigend empfinden, was der alltagspsychologischen Annahme widerspricht, dass Menschen etwas nur dann wollen, wenn sie auch Spaß daran haben. Inzwischen weiß man, dass zwischen den expliziten und impliziten Motiven eine Lücke klaffen kann, d. h., man kann durchaus davon überzeugt sein, dass man sehr ehrgeizig ist, in Wahrheit aber gar keine Freude daran hat, nur Höchstleistungen zu erbringen. Dass implizite und explizite Motive auseinander klaffen, liegt vor allem daran, dass sich Menschen ihrer eigenen Motive nur ganz selten bewusst sind. Wenn Menschen über sich sprechen, erfassen sie meist nur die expliziten Motive, also das Bild, das sich eine Person von ihren eigenen Beweggründen macht. Doch besitzt jeder Mensch auch angeborene und unveränderbare implizite Motive, wodurch der Konflikt zwischen Vorstellung und Wirklichkeit vorprogrammiert ist. Eine Methode, um implizite und explizite Motivation einander näher zu bringen, ist die Visualisierung seiner Motive. Implizite Motive bauen bekanntlich aus Emotionen und Bildern auf, während explizite Motive in der Regel auf Sprache basieren, sodass jemand, der sich vorstellt, was seine Motive konkret im Alltag bedeuten würden, allmählich sein Selbstbild allmählich in die Richtung seines tatsächlichen Selbst führt.
Video zur Wirksamkeit von intrinsischer und extrinsischer Motivation
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
Schon bei Aristoteles gibt es zwei Arten der Motivation
Aristoteles stellt zu Beginn seiner Nikomachischen Ethik fest: "Jede Kunst und jede Lehre, ebenso jede Handlung und jeder Entschluß scheint irgendein Gut zu erstreben. Darum hat man mit Recht das Gute als dasjenige bezeichnet, wonach alles strebt." Ein Streben benötigt immer einen Gegenstand, ein Ziel (telos) des Strebens. Das Ziel oder der Zweck kann ein Werk oder ein Produkt sein, z.B. eine wissenschaftliche Arbeit. Das gehört zur Kunst oder Kunstfertigkeit (techné). Bei einer techné wie der Wissenschaft ist folglich das telos das ergon (Werk, Ergebnis, Produkt). Die Tätigkeit kann aber auch selber das Ziel sein, wie das z.B. beim "Leben als Wissenschaftler“ der Fall ist, welches Aristoteles als Selbsttätigkeit, Selbstbewegung bestimmt. Das telos ist also die energea (Tätigkeit, Aktivität) selbst. Somit geht Aristoteles von zwei verschiedene Arten von Zielen aus: entweder liegt das Ziel in der Tätigkeit selbst (intrinsich), oder eben außerhalb dieser Aktivität (extrinsisch).
Der instinkttheoretische Ansatz
Nach Darwin sind Instinkt genauso evolutionär entwickelt, wie körperliche Merkmale. Ein Instinkt ist die Handlung eines jungen, unerfahrenen Lebewesens, die anderer Lebewesen der gleichen Art ebenfalls ausführen und die erfolgt, ohne das ihr Zweck bekannt ist. Lorenz untergliedert eine Instinkthandlung in in Appetenzverhalten und Endhandlung. Appetenzverhalten ist bei vielen Arten noch modifizierbar, während die Endhandlung meist stereotyp abläuft. Im Zusammenhang mit dem Appetenzverhalten treten Emotionen auf. Beim Menschen sind diese Emotionen oft die rudimentären Reste einer Instinkthandlung.
Ein Schlüsselreiz ist derjenige Reiz, der eine Instinkthandlung auslöst. Dabei muß allerdings eine Bereitschaft da sein, die Handlung überhaupt auszuführen, da sonst auch der Schlüsselreiz wirkungslos bleibt. Lorenz setzt eine innere Triebproduktion voraus. Der Drang, eine Handlung auszuführen, wächst mit der Zeit, bis zur letzten Ausführung der Handlung. Dem Schlüsselreiz entspricht der sensorische Mechanismus, der angeborene Auslösemechanismus (AAM).
Der Psychoanalytischer Ansatz
Die als Triebbefriedigung beschriebene Aufhebung eines inneren Reizzustandes ist in der Regel mit einem positiven Affektzustand verbunden. Trieb und Affekt, Motivation und Emotion sind miteinander verbunden.
Behavioristische Ansätze
Als primäre Triebe werden Hunger, Durst und Sexualität angesehen. Unter sekundären Trieben versteht man die Grundannahme, dass bestimmte Sachverhalt auch aufgrund von Lernerfahrungen, die der Organismus macht, die Eigenart eines Triebes erlangen kann. Erworbene Triebe basieren auf Emotionen. Auch bekräftigende Eigenschaften situativer Reize können konditioniert werden. Wird ein zunächst neutraler Reiz gepaart mit einem vital bedeutungsvollen Ereignis, so erwirbt der neutrale Sachverhalt sekundären Belohnungswert. Er wirkt dann ebenfalls als Anreiz im Verhalten und verstärkt Verhalten in dem Sinne, dass die Auftretenshäufigkeit des entsprechenden Verhaltens relativ erhöht wird, wenn der unbedingte Reiz nicht mehr nicht mehr geboten wird. Werden solche sekundären Verstärker allerdings nicht mehr mit den primären zusammen geboten, so verlieren sie sehr schnell ihre Wirksamkeit.
Donald O. Hebb (1904-1985) fand, dass organismische Bedürfnisse zu einer gesteigerten zentralnervösen Aktivierung beitragen, gesteuert durch den Aktivierungstonus der Formatio reticularis. Er verwendet den Begriff Erregung (arousal) und beschrieb zwei neuronale Systeme: Das erste System kontrolliert die Erregung, die aus dem Reizstrom resultiert (formatio reticularis, Areale des Hypothalamus, Kontrollzentren in der Amygdala. Das zweite System kontrolliert die Aktivierung der Reaktionsmechanismen, was eher im sind einer tonischen physiologischen Verhaltensbereitschaft zu sehen ist (Basalganglien des Vorderhirns). Die Aktivierung bewirkt eine Verstärkung des Verhaltens. Eine Aktivierung über den positiven Bereich hinaus kann negativ und bestrafend wirken.
Robert Woodworth führte die Motivation als ein Konzept eines inneren Triebs ("drive"), der das Verhalten bestimmt, ein. Er definiert Trieb im biologischen Sinn als Energie, die ein Organismus freisetzt, als "Treibstoff für Handlungen, der durch Reize ausgelöst und für zielgerichtete Handlungen bereitgestellt wird.
 Das bedeutendste behavioristische Modell entwickelte Clark L. Hull. Er formulierte eine
"Verstärkungstheorie des Lernens" in Form des Lernens
am Erfolg. Verstärkung definiert er als (relative)
Bedürfnisbefriedigung, wobei der Lernvorgang sowohl vom
Auftreten des Reizes als auch vom Organismus und dessen
Bedürfnissen abhängt. Danach tragen alle
Bedürfnisse zu einem einheitlichen Trieb bei, der alle
Reaktionsweisen gleichermaßen energetisiert und zwar
in dem Maße, wie diese Reaktionen aufgrund
unterschiedlicher Gewohnheitsstärken bereitstehen. Es
werden nur solche Verhaltensweisen wiederholt, wenn sie zu
einer Triebreduktion führen. Triebreduktion wird
zur Voraussetzung des Lernens. Der Trieb energetisiert, das
Verhalten wird durch Gewohnheiten und frühere
Erfahrungen bestimmt. Hull ist der Meinung, dass
Primärtriebe biologisch bedingt sie und sie dann
ausgelöst werden, wenn der Organismus sich in einem
Mangelzustand befindet. Diese Triebe aktivieren den
Organismus. Wenn z.B. einem Tier viele Stunden lang Futter
entzogen wird, wird ein Hungergefühl ausgelöst,
das Nahrungssuche und Freßverhalten motiviert. Die
Reaktionen des Tieres, die zur Nahrungsaufnahme führen,
werden verstärkt, weil sie mit Spannungsreduktion, die
das Fressen hervorruft, assoziiert werden. Die Hullsche
Theorie erwies sich jedoch als nicht haltbar, denn Lebewesen
zeigen über die Befriedigung ihre existentiellen
Bedürfnisse hinaus zielstrebige Verhaltensweisen.
Das bedeutendste behavioristische Modell entwickelte Clark L. Hull. Er formulierte eine
"Verstärkungstheorie des Lernens" in Form des Lernens
am Erfolg. Verstärkung definiert er als (relative)
Bedürfnisbefriedigung, wobei der Lernvorgang sowohl vom
Auftreten des Reizes als auch vom Organismus und dessen
Bedürfnissen abhängt. Danach tragen alle
Bedürfnisse zu einem einheitlichen Trieb bei, der alle
Reaktionsweisen gleichermaßen energetisiert und zwar
in dem Maße, wie diese Reaktionen aufgrund
unterschiedlicher Gewohnheitsstärken bereitstehen. Es
werden nur solche Verhaltensweisen wiederholt, wenn sie zu
einer Triebreduktion führen. Triebreduktion wird
zur Voraussetzung des Lernens. Der Trieb energetisiert, das
Verhalten wird durch Gewohnheiten und frühere
Erfahrungen bestimmt. Hull ist der Meinung, dass
Primärtriebe biologisch bedingt sie und sie dann
ausgelöst werden, wenn der Organismus sich in einem
Mangelzustand befindet. Diese Triebe aktivieren den
Organismus. Wenn z.B. einem Tier viele Stunden lang Futter
entzogen wird, wird ein Hungergefühl ausgelöst,
das Nahrungssuche und Freßverhalten motiviert. Die
Reaktionen des Tieres, die zur Nahrungsaufnahme führen,
werden verstärkt, weil sie mit Spannungsreduktion, die
das Fressen hervorruft, assoziiert werden. Die Hullsche
Theorie erwies sich jedoch als nicht haltbar, denn Lebewesen
zeigen über die Befriedigung ihre existentiellen
Bedürfnisse hinaus zielstrebige Verhaltensweisen.
Hull nahm bei seiner Triebtheorie übrigens auch an, dass Motivation eine notwendige Vorraussetzung für Lernen sei, denn Lernen sei eine wesentliche Bedingung für eine erfolgreiche Anpassung aller Lebewesen an die Umwelt.
Emotionspsychologische (anreiztheoretische) Ansätze
Emotionen werden, sobald sie auftreten, zu mächtigen Motivatoren künftigen Verhaltens. Sie bestimmen ebenso den Kurs des Handelns von einem Moment zum nächsten, wie sie die Segel für langfristige Ziele setzen. Anreiztheoretische Ansätze gehen also davon aus, dass die Antizipation von Verstärkern gelernte Triebquellen seien. Mowrer machte die Motivation vollständig abhängig von Anreizen. Dieses System ist jedoch stark verallgemeinernd. Es betrachtet die Emotionen nur auf der Lust-Unlust Dimension und die Motivation nur auf der Dimension Suchen-Meiden.
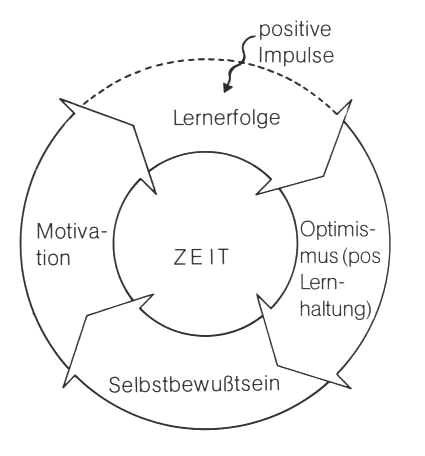
[Kreislaufprozeß der Motivation nch Hüholdt 1998, S. 67]
Konsistenztheorie der Motivation
Menschliches Handeln erfolgt nach Grawe (1998) zielgerichtet und dient der Befriedigung von Grundbedürfnissen, wobei im Rahmen der Konsistenztheorie das psychische Erleben des Menschen im Kontext der Befriedigung von Grundbedürfnissen betrachtet wird. Diese menschlichen Grundbedürfnisse werden im Zuge der individuellen Entwicklung ausdifferenziert und in individuelle motivationale Ziele operationalisiert, wobei die Annäherung an diese Ziele oder die Erreichung mit dem Erleben positiver Emotionen verbunden ist. Wenn ein Mensch seine motivationalen Ziele nicht oder nur ungenügend umsetzen kann, entsteht motivationale Inkongruenz bezeichnet, wobei das Streben nach Kongruenz als ein übergeordnetes Prinzip psychischer Prozesse zu betrachten ist.
Kongruenz bzw. Inkongruenz wirkt dabei stets in Bezug auf die jeweilige individuelle Transformation dieser Bedürfnisse in Ziele, also das Auseinanderklaffen motivationaler Ziele als Ausdruck von Bedürfnissen und wahrgenommener Realität, die diese Bedürfnisse aktuell nicht befriedigt. Um Bedürfnisse befriedigen zu können, bilden Menschen im Laufe ihrer Lerngeschichte nicht nur motivationale Ziele aus, sondern sie erwerben auch Mittel zur Verfolgung dieser Ziele. Dabei erlernen Menschen in Abhängigkeit ihrer individuellen Voraussetzungen und der Voraussetzungen ihrer Umwelt Fertigkeiten, die ihnen in bestmöglicher Anpassung an ihre Umwelt erlauben, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen und Verletzungen dieser zu vermeiden. Diese Fertigkeiten sind daher Ressourcenpotentiale, wobei eine aktive Nutzung von Ressourcen stets dem Zweck dient, Wahrnehmungen im Sinne der Grundbedürfnisse zu machen. Das Ausmaß, in dem Ressourcen aktuell realisiert werden, kann somit ein Maß für das aktuelle Kongruenzerleben im Hinblick auf diese Grundbedürfnisse betrachtet werden. Das bedeutet, dass die Konsistenz von motivationaler Kongruenz abhängt, wobei je stärker die motivationale Kongruenz bei Menschen ausgeprägt ist, desto besser auch die psychische Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
Literatur
Grawe, Klaus (1998). Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe.
Feldtheoretischer Ansatz
Kurt Lewins Konzept der Motivation beinhaltet die Prinzipien des Hedonismus und der Homöostase. Lewin ist Phänomenologe bzw. Feldtheoretiker, d.h. er betont vor allem die wahrgenommene und weniger die objektive Umwelt. Die Feldtheorie geht von der Annahme aus, dass Verhalten durch das zu einem bestimmten Zeitpunkt existierenden Feld determiniert wird. Der Begriff des Feldes umfaßt Bedingungsfaktoren sowohl der "äußeren" Situation (der Umgebung) wie der inneren Situation (der Person) und das konkrete Verhalten ist eine Funktion beider.
Nach Lewin wird menschliches Verhalten durch bestimmte Situationen und Umwelteinflüsse mitbestimmt. Z.B. kann ein Problem oder eine unfertige Aufgabe eine Spannung erzeugen, bis eine Lösung also eine Bedürfnisbefriedigung erreicht ist. Die von der Umwelt gegebenen Anreize können verschieden stark auf eine Person wirken, je nachdem ob die damit verbundene Handlung positiv oder negativ belegt ist. So kann der Arbeitsauftrag "Lesen eines Buches" einen hohen Aufforderungscharakter besitzen, wenn die Person bereits gute Erfahrung mit dieser Tätigkeit gemacht hat.
Siehe dazu auch das Allgemeine Lernmodell nach Lewin
Modell der Leistungsmotivation
Atkinson betrachtet die Leistungsmotivation als Ergebnis eines Konfliktes zwischen Annährungs- und Vermeidungstendenzen. Ob eine Person eine Leistung in Angriff nimmt oder ihr aus dem Weg geht, ist abhängig von "Hoffnung auf Erfolg" mit dem nachfolgenden Gefühl des Stolzes bzw. "Furcht vor Mißerfolg" mit dem damit verbundenem Gefühl der Scham.
Atkinsons Risikowahlmodell splittet das Leistungsmotiv in eine negative Vermeidungskomponenteund eine positive Annährungkomponente auf und verknüpft diese beiden Komponenten mit einer situationsabhängigen Erfolgserwartung in Formeln: L = M x (1-W) x W Unter Einbezug des Erfolgsmotivs und des Mißerfolgsmotivs: L = Me x (1-W) x W - Mm x W x (1-W )- Zusammengefaßt: L = (Me - Mm) x (W x (1-W)) L = Stärke der Leistungsmotivation Ein Erfolg ist um so attraktiver und motivierender, je riskanter er ist. Das Leistungsmotivation steigt, je stärker das individuelle Erfolgsmotiv das Mißerfolgsmotiv übersteigt und je näher die Erfolgswahrscheinlichkeit am maximal motivierenden Wert 0,5 liegt. Erfolgsmotivierte sind höher motiviert bei Aufgaben mittlerer subjektiver Schwierigkeit, Mißerfolgsmotivierte bei sehr schweren und sehr leichten Aufgaben. |
Ein leistungsmotiviertes Handeln findet dann statt, wenn die Tendenz "Hoffnung auf Erfolg" die Tendenz "Furcht durch Mißerfolg" überwiegt. Aber auch bei in diesem Sinne niedrig leistungsmotivierten Personen (Überwiegen von Furcht vor Mißerfolg), kann es zu einem insgesamt mittleren bis hohen Maß von Anstrengung und Ausdauer beim Leistungshandeln kommen. Dies findet dann statt, wenn eine extrinsische Komponente zu der intrinsischen Komponente hinzukommt. Dabei kann es sich um positive Verstärkung (Versprechen einer Belohnung) oder um die negative Verstärkung (Zwang etwas tun zu müssen) handeln.
Man spricht von einem leistungsmotivierten Menschen, wenn dessen Motivation durch die Erreichung selbstgesetzter Ziele steigt. Er erlangt Befriedigung daraus, aus eigenen Kräften Einfluss auf die Ergebnisse zu haben. Durch eine reizvolle Gestaltung der Arbeitsaufgabe etwa kann seine Motivation gesteigert werden, während man mit materiellen Anreizen nur eine geringe Leistungssteigerung erreichen wird.
Die Leistungsmotivation läßt sich demnach durch eine Formel ausdrücken, die eine intrinsische mit einer extrinsischen Komponente verbindet. Ein intrinsisch leistungsmotiviertes Handeln findet besonders dann statt, wenn die Tendenz "Hoffnung auf Erfolg" die Tendenz "Furcht vor Mißerfolg" überwiegt. Leistungsmotivation ist daher das Vermögen, Erfolg als durch internale Faktoren verursacht zu erleben, insbesondere durch Anstrengung
Möchte man z.B. erreichen, dass Schüler vorwiegend intrinsisch motiviert sind, dann ist eine Voraussetzung hiefür, dass sie bei ihren Aktivitäten häufig Erfolge erzielen. Besonders bei niedrig leistungsmotivierten Menschen steigert Erfolg die Leistung, während Mißerfolg ihre Leistungsbemühungen hemmt. Bei Schülern mit hoher Leistungsmotivation können dagegen Misserfolge die Leistungsbemühung noch steigern.
Unter pädagogisch-didaktischer Perspektive war es das Verdienst Heckhausens darauf hinzuweisen, dass von Seiten der Lehrenden der Erreichbarkeitsgrad eines Zieles, der Anreiz der Aufgabe und der Neuigkeitsgehalt von Informationen höchstes Augenmerk zu schenken ist. Die Forschung hat deutlich gezeigt, wie wichtig Schwierigkeitsdosierungen für die Motivierung im Unterricht sind, die den Fähigkeiten der einzelnen Schüler Rechnung tragen.
Anreizstruktur der Aufgabe und Motivstruktur der Person
Sorrentino und Sheppard (1978) zeigten in einer Studie mit Leistungsschwimmern durchführten, dass es von Vorteil sein kann, die Anreizstruktur der Aufgabe an die Motivstruktur der Person anzupassen, denn während hoch leistungsmotivierte Schwimmer ihre besten Leistungen in Einzelwettbewerben erbrachten, schwammen hoch anschlussmotivierte Schwimmer am schnellsten, wenn sie an Staffelwettbewerben teilnahmen. Die Motivation der Sportler hing also davon ab, in welche Anreizstruktur der Wettkampf eingebettet war. Wenn man also die Motivstruktur eines Sportlers kennt, dann kann man versuchen, die Anreizstruktur des anstehenden Wettkampfes mit seinem dominanten Motiv in Einklang zu bringen. Gegenüber leistungsmotivierten Sportlern kann man während der Vorbereitung die Bedeutung von Gütemaßstäben wie das Übertreffen der eigenen bisherigen Bestzeit betonen, während man bei einem hoch machtmotivierten Schwimmer eher die Anreize eines Sieges für sein Machtmotiv thematisiert wie das Entthronen des gegenwärtigen Titelträgers. Anschlussmotivierte Schwimmer kann man eher mit der Aussicht motivieren, mit einem Sieg ihren Verein und die Teamkollegen weiterzubringen.
Literatur
Sorrentino, R. M. & Sheppard, B. H. (1978). Effects of
affiliation-related motives on swimmers in individual vs. group
competitions: A field experiment. Journal of Personality and Social
Psychology, 36, 704-714.
Theorie der Attribution - Locus of Control
Menschen haben nach Weiner das Bedürfnis, Phänomene, wie Erfolg und Mißerfolg nicht nur zu registrieren, sondern diese auf bestimmte Bedingungen bzw. Ursachen zurückzuführen, d.h., sie zu attribuieren.
Weiner geht bei seiner Weiterentwicklung daher davon aus, dass man für Erfolg und Mißerfolg innere (in der Person liegende) und äußere (in der Situation liegende) Gründe annehmen kann.
Sowohl bei der internalen (auf die Person bezogen) wie auch bei der externalen (auf die Situation bezogenen) Attribution können die Gründe zusätzlich stabil (zeitlich überdauernd) oder variabel (innerhalb einer Zeitspanne sich verändernd) sein. Das Klassifikationsschema der Gründe für Handlungsergebnisse läßt sich wie folgt darstellen:
|
internal |
external |
variabel |
Anstrengung |
Zufall |
stabil |
Fähigkeit |
Schwierigkeit |
- Kombination internal - variabel führt zur Attribution auf die eigene Anstrengung,
- Kombination internal - stabil führt zur Attribution auf die eigene Fähigkeit,
- Kombination external - stabil führt zur Attribution auf die Schwierigkeit der Aufgabe
- Kombination external - variabel führt zur Attribution auf unkontrollierbare Einflüsse, wie Glück oder Zufall
Erfolg und Mißerfolg können nach dieser Auffassung durch die handelnde Person (ihre überdauernde Fähigkeit oder einmalige Anstrengung) oder durch situative Faktoren (Schwierigkeit einer Aufgabe verändert sich normalerweise nicht oder zufälliges Glück oder Pech) begründet sein. Menschen verhalten sich nicht immer rational. Untersuchungen zeigen jedoch die Tendenz, Erfolge eher der eigenen Person und Mißerfolge eher widrigen Umständen der Situation zuzuschreiben. Auf diese Weise ist es der Person möglich, eine Beeinträchtigung ihres Selbstwertgefühles zu vermeiden. Das läßt sich anschaulich anhand von Testergebnissen zu einer Untersuchung des Locus of Causality (LoC) demonstrieren (Stangl 1990). Die Daten zu deb jeweils unterschiedlichen Attribuierungsmodi bei Erfolg bzw. Mißerfolg entsprechen signifikant den theoretischen Annahmen.
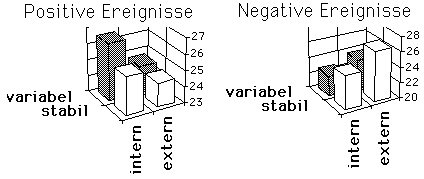
Lehrer erleben ihre Tätigkeit oft als sehr schwierig, da oft Mißerfolge auftreten. Es wird unterstellt, dass die Probleme von Schülern verursacht werden. Eine solche external - stabile Ursachenzuschreibung wirkt auf die Lehrer demotivierend, weil die Schwierigkeit auf äußere (gesellschaftliche) Bedingungen zurück geführt werden, die kaum beeinflussbar sind. Dies ist unter psychohygienischen Gesichtspunkten problematisch, da mangelnde Arbeitszufriedenheit leicht zur "inneren Kündigung" (Ausbrennen) führen kann.
Wie attribuieren Sie?
Das Neugiermotiv
Für die Lernmotivation spielt die angeborene Neugier eine wichtige Rolle. Das Neugiermotiv ist ein originäres, biogenes Motivsystem, das in der Ontogenese einer erfahrungsbedingten Modifikation unterworfen ist. Die einfachste Form von Neugier ist die Orientierungsreaktion im Sinne Pawlows. Man unterscheidet spezifisches und diversives Neugierverhalten:
- Spezifisches Neugierverhalten wird von Anreizen der Umwelt ausgelöst. Diese Anreize sind kollativ, da sie nur im Vergleich zu anderen Sachverhalten und auf ein Individuum zutreffen.
- Diversives Neugierverhalten tritt in monotonen Situationen auf und beweist, dass Mensch und Tier ein Verlangen nach Abwechslung, Stimulation und Information haben. Dieses Bedürfnis nach Stimulation wurde mit einem homöostatisch funktionierenden Informationsbedürfnis erklärt, das ähnlich wie Hunger und Durst arbeitet.
Es gibt interindividuelle Unterschiede im Neugierverhalten, wobei diese auch intern bedingt sein können und nicht nur vom Reiz abhängen. Einige Befunde deuten auf einen dispositionellen genetischen Faktor hin. In Zwillingsstudien fand sich ein Erblichkeitsanteil von 58 - 68 %.
Im Detail siehe Neugier ein spezielles Motiv
Methoden der Motivationspsychologie
Die Motivationsforschung verwendet neben dem Experiment auch Verhaltensbeobachtung, und beim Menschen oft Befragungsmethoden.
Nach Wundt sind die Kennzeichen eine Experimentes:
- die Willkür in der Herstellung der Bedingungen
- die Wiederholbarkeit
- die Variierbarkeit der Bedingungen
Die Variation und Kontrolle der unabhängigen Variable ist die wichtigste Bedingung für ein Experiment, sowie die Beobachtung der dadurch bedingten Veränderung in der abhängigen Variable.
Da oft die Herstellung bestimmte unabhängiger Variablen aus ethischen Gründen nicht möglich ist, verstößt die Motivationsforschung gegen die erste Bedingung des Experiments in der Psychologie: Sie stellt keine sachliche Identifikation des Untersuchungsgegenstandes sicher. Darunter versteht man die Übereinstimmung des in der Wirklichkeit gegebenen Sachverhaltes mit dem Gegenstand, der untersucht werden soll und der zur Darstellung gelangt.
Messung von Motiven
Es wird vornehmlich mit zwei Verfahren gearbeitet:
- Direkte Verfahren sind Fragebogenuntersuchungen, bei denen direkt nach Motiven gefragt wird. Dabei entsteht die Gefahr der Antwort im Sinne der sozialen Erwünschtheit.
- Der Thematische Apperception-Test (TAT) ist ein projektives Verfahren, bei dem der Proband zu einer Reihe von Bildern eine Geschichte erfinden muß. Durch die inhaltliche Analyse kann mand die Motive und Handlungstendenzen der Personen erfahren.
Der TAT besitzt eine hohe Vorhersagegenauigkeit, wenn in der Situation tätigkeitsbezogene Anreize vorliegen. Der Fragebogen besitzt dagegen eine hohe Vorhersagegenauigkeit, wenn in der Situation eher soziale Anreize vorliegen.
Die Gittertechnik von Schmalt versucht die beiden Verfahren zu vereinigen. Die Probanden bekommen Bilder vorgelegt und können anhand mehrerer Vorgaben sich für eine Antwortmöglichkeit entscheiden.
Motivation und Lernen
Einen Überblick über die Effekte der Motivation auf das Lernen bzw. das Lernergebnis gibt die Arbeit von Schiefele und Schreyer (1994, S. 11). So ergibt ihre Metaanalyse, dass intrinsische Lernmotivation 19% der Varianz des tiefergehenden Lernens aufklärt. Extrinsische Lernmotivation hingegen steht nur mit oberflächenstrategischem Lernen in signifikantem Zusammenhang (5% Varianzaufklärung). Mangelnde Motivation wirkt sich grundsätzlich auf die Bereitschaft aus, sich überhaupt mit der Bewältigung einer Aufgabe zu beschäftigen, sich mit zunächst Unbekanntem und Neuem auseinanderzusetzen, und auf die Dauer der Beschäftigung.
Extrem hohe Leistungsmotivation kann z.B. in einer sehr hohen Bearbeitungsgeschwindigkeit resultieren, die aber zu einem Genauigkeitsverlust führt bzw. zu einer Steigerung der Fehlerquote (Problem des Verhältnisses von Güte und Menge). Eine sehr hohe motivationsbedingte Mengensteigerung beim Lernen bzw. der Gestaltung der Lernsituation hätte ihr lernstrategisches Korrelat in der Bevorzugung oberflächentypischer Lernstrategien: z.B. viel lesen, viel auswendig lernen, viel Material sammeln. Andererseits kann eine mittlere Motivation zu tiefenstrategisch orientierten Lernprozessen führen, wie z.B. kritische Zusammenfassungen, Reflexion, Vertiefungen. In diesem Sinn läßt sich das Yerkes-Dodson-Gesetz (1908), das einen Leitungsabfall bei sehr starker Motivation/Erregung prädiziert, interpretieren.
Literatur
Yerkes, Robert M. & Dodson, John D. (1908).
The relation of strength of stimulus to rapidity of
habit-formation. Journal of Comparative Neurology and
Psychology, 18, 459-482.
WWW: http://psychclassics.yorku.ca/Yerkes/Law/ (01-12-01)
Schiefele, U., Schreyer, I. (1994). Intrinsische
Lernmotivation und Lernen. Zeitschrift für
Pädagogische Psychologie, 8,1-13.
Das Yerkes-Dodson-Gesetz
Dieses Gesetz beschreibt im Speziellen die Beziehung zwischen optimaler Stärke der Motivation und Schwierigkeit einer Lernaufgabe des Diskriminierens. Allgemein definiert es den Zusammenhang zwischen Leistungsfähigkeit und Motivation bzw. dem Erregungsniveau eines Individuums. Das Yerkes-Dodson-Gesetz ist durch Generalisierung aus Lernversuchen mit Ratten gewonnen worden: Ratten lernen eine schwierige Diskriminierung bei schwacher Motivierung rascher als bei starker, während leichtere Aufgaben auch bei starker Motivierung gleich gut gelernt werden.
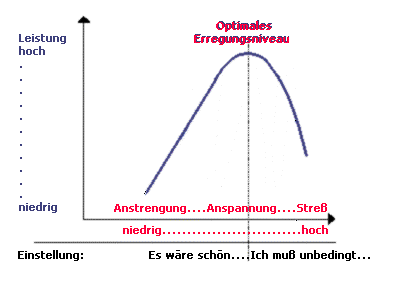
Hohe intrinsische Lernmotivation sollte sich auf Kenntnisse und Prozeduren beziehen, die besonders mit einer differenzierten und gründlichen Aneignung des Lerngegenstandes zu tun haben (Tiefenstrategien des Lernens), während extrinsische Motivation auf oberflächliche Strategien, die auf das schnelle Erreichen von Zielen ausgerichtet sein sollten (oberflächliche Lernstrategien) (vgl. Schiefele & Schreyer, 1994).
Dieser Zusammenhang wird in der Psychologie auch unter
dem Aspekt des ![]() Stresskonzeptes untersucht, da sich das Individuum im Sinne des "reziproken
Determinismus" (Bandura) seine eigenen Stressoren
verschaffen bzw. setzen kann. Dies geschieht insbesondere im
Falle intrinsischer Motivation, also dann, wenn das
Individuum sich seine eigenen Leistungsziele setzt und sein
Anspruchsniveau ständig erhöht (Selbststress).
Stresskonzeptes untersucht, da sich das Individuum im Sinne des "reziproken
Determinismus" (Bandura) seine eigenen Stressoren
verschaffen bzw. setzen kann. Dies geschieht insbesondere im
Falle intrinsischer Motivation, also dann, wenn das
Individuum sich seine eigenen Leistungsziele setzt und sein
Anspruchsniveau ständig erhöht (Selbststress).
Diese manchmal auch als "Typus A" bezeichneten Menschen sind durch extremen Ehrgeiz, Konkurrenzdenken, starke Identifikation mit seiner Arbeit, ständige Zeitknappheit, Ungeduld und unterschwellige Feindseligkeit gekennzeichne und neigen zu Erkrankungen der Koronararterien, wobei das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden für diesen Typ doppelt so hoch wie bei anderen Menschen ist. Das Ausmaß der tatsächlichen Belastung und Stressempfindung hängt häufig mit einer Übersteigerung der eigenen Ansprüche an sich selbst zusammen. Viele Stressgeplagte erwarten von sich immer hunderprozentige Leistung, und dieses Muss-Denken begleitet sie in vielen Bereichen ihres Lebens, also etwa neben der Arbeit auch in der Freizeit. Auch Atkinson (1964) vermutet, dass ein Zustand der Übermotivation (im Sinne von: "etwas unbedingt wollen") als Stressfaktor wirkt.
Bildquelle:
Sest, B. (2000). Konflikt und Stress.
WWW: http://members.chello.at/guenther.holmann/stress/stress.doc (03-01-24)
Die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg (1959)
Frederick W. Herzberg führte mit einem Forschungsteam in den fünfziger Jahren eine Untersuchung durch, die später den Namen Pittsburgh Study erhielt. Dabei ging es darum, bei höher gebildeten Angestellten, meist Ingenieure und Kaufleute, herauszufinden, welche Arbeitssituationen als positiv und welche als negativ empfunden werden. Im Ergebnis der Untersuchung stellte man fest, dass die Antworten in zwei Kategorien einzuordnen waren, und zwar in die Zufriedenheit schaffenden Faktoren und zum anderen in die Unzufriedenheit hervorrufenden Faktoren. Frederick Herzberg und Mitarbeiter (1959) entwickelten daraus die "Zwei-Faktoren-Theorie", deren Kernannahme besagt, dass Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit der Arbeit von zwei Faktorengruppen beeinflusst werden:
- Motivatoren (satisfiers) bewirken Zufriedenheit, während
- Hygienefaktoren (dissatisfiers) Unzufriedenheit auslösen können, aber nicht Zufriedenheit bewirken.
Als Hygienefaktoren stellten sich etwa die Bezahlung, geregelte,
angemessene Arbeits-, Pausen- und Urlaubszeiten, der Umgang miteinander
und entsprechende Arbeitsplatzgestaltung und –ausstattung heraus. Bei
Motivationsfaktoren, die als Auslöser für Zufriedenheit gelten, handelte
es sich weniger um äußere Merkmale, sondern um innere Faktoren wie
Erfolg, Anerkennung, Wertschätzung, Herausforderung,
Entwicklungsmöglichkeiten, Eigenverantwortung und andere. Es zegte sich
auch, dass das Fehlen von Motivationsfaktoren durch Hygienefaktoren
nicht ersetzt werden kann, wenn auch nicht unzufrieden sein nicht
gleichbedeutend mit zufrieden also motiviert sein. Ein Mangel an
Motivation und Zufriedenheit wirkt sich auf die Einstellung zur Arbeit
und letztlich dem Unternehmen gegenüber viel negativer aus als nur
Unzufriedenheit mit dem einen oder anderen äußerlichen Umstand.
Bei der von Herzberg angewendeten Methode der kritischen Ereignisse
wurden die Befragten gebeten, Situationen aus ihrem Arbeitsleben zu
erzählen, die sie besonders positiv bzw. besonders negativ empfunden
haben und auch die Ursachen dafür anzugeben. Genau wie Maslow
beschäftigt sich Herzberg mit der Frage, was einen Menschen zu einem
gewissen Verhalten motiviert. Sie befassten sich mit den Motiven und
Bedürfnissen der Menschen sowie deren Inhalten und versuchten diese in
Kategorien einzuteilen und ihre Beziehungen zueinander offenzulegen. Sie
versuchten zu erkennen, welche Motive hinter dem Verhalten einer Person
stecken und daraus in weiterer Folge Empfehlungen für ein Anreizsystem
zu geben. Anders als Maslow unterteilte Herzberg die
Grundbedürfnisse der Menschen nicht in mehrere Stufen sondern in zwei Kategorien, nämlich die
Hygienebedürfnisse und die Motivationsbedürfnisse. Motivatoren hängen sabei unmittelbar mit
dem Inhalt der Arbeit zusammen und werden daher auch als
"Kontentfaktoren" bezeichnet. Hygienefaktoren beziehen sich auf die
Arbeitsumgebung und werden deshalb auch als
"Kontextfaktoren" bezeichnet. Während
Anerkennung, die Tätigkeit selbst, Verantwortung,
Weiterentwicklungs und Aufstiegsmöglichkeiten
intrinsisch motivierend wirken und zu Zufriedenheit
führen, aber nicht Unzufriedenheit auslösen,
können Bezahlung, Führungsstil, Status,
Arbeitsumgebung, Beziehungen zu Kollegen,
Unternehmenspolitik bei Frustration zu Unzufriedenheit
führen.
Die wichtigste Erkenntnis und gleichzeitig praktische Konsequenz aus der Theorie ist die Idee, dass Motivation mit der Möglichkeit zu persönlichem Wachstum verbunden ist und auf dem Bedürfnis ständiger Weiterentwicklung basiert. Menschen sind dann mit ihrer Arbeit zufrieden, wenn sie interessant und herausfordernd ist. Das Management kann also eigentlich die Mitarbeiter nicht motivieren, aber es kann eine Arbeitsumgebung und Arbeitsbedingungen schaffen, die es Arbeitenden erlaubt, sich selbst zu motivieren.
Der eigentliche Wert der vielfach kritisierten Zwei-Faktoren-Theorie liegt darin, dass sie vor allem dazu beigetragen hat, die Arbeitsbedingungen und Arbeitsgestaltung in das Zentrum des Interesses der Organisationspsychologie zu rücken. Die wichtigste Erkenntnis seiner Theorie war, dass Zufriedenheit und Unzufriedenheit der Mitarbeiter nicht von denselben Faktoren abhängen, was bedeutet, dass man, um Zufriedenheit zu erlangen, andere Anreize setzen muss, als um Unzufriedenheit zu vermeiden.
Vergleicht man nun die beiden Faktoren, so kann man erkennen, dass es
sich bei den Hygienefaktoren zum großen Teil um extrinsische Anreize
und bei den Motivatoren um intrinsische Anreize
handelt. Mitarbeiter sind demnach dann zufrieden, wenn ihre Aufgaben
herausfordernd und interessant sind. Es ist also die Aufgabe des
Managements die intrinsische Motivation der Mitarbeiter zu fördern, was sie durch die richtige Gestaltung der Arbeitsaufgaben und –bedingungen erreichen können.
Das Modell von Herzberg findet bis heute praktische Anwendungen, doch beruht es, der damaligen Zeit entsprechend, auf der ausschließlichen Motivation des Angestellten durch den Vorgesetzten, wobei das nach heutiger Auffassung nur noch einen Aspekt der Mitarbeitermotivation darstellt und wird maßgeblich durch Selbstmotivation der Angestellten ergänzt werden muss.
SuperMotivation-Ansatz des Lernens von Spitzer (1996)
Der von D. R. Spitzer entwickelt SuperMotivation-Ansatz des Lernens beruht auf der Kernannahme, "any activity can be made highly motivating if a motivating context" is added to the basic task" (Spitzer 1996, S. 45), sodass die einfache Regel gilt: Je mehr "Motivatoren" der Kontext einer Tätigkeit enthält, um so motivierender wird diese Tätigkeit empfunden. Spitzer bietet eine pragmatische Liste von Motivatoren an, die zur Gestaltung und Bewertung motivationsfördernder Elemente von Lernumgebungen verwendet werden kann.
- Action (Aktion): Aktive Teilnahme am Lernprozess ist wichtig, diese Aktivität kann sowohl physischer als auch mentaler Natur sein. Die Interaktivität des Lernsystems ist dabei einer der betrachteten Aspekte.
- Fun (Spaß): Dieser Bereich wird wohl am häufigsten mit Motivation assoziiert. Spaß am Umgang mit dem Lernsystem durch Einsatz humorvoller, überraschender Elemente kann Interesse wecken und steuern. Hier ist jedoch Vorsicht geboten. Humor kann in einigen Fällen übertrieben und lästig wirken, zumal das Humorverständnis auch stark kulturell geprägt ist.
- Variety (Abwechslung): Spitzer empfiehlt eine möglichst breite Verwendung unterschiedlicher Medien, Ressourcen und Tätigkeiten.
- Choice (Auswahl): Innerhalb des Angebots an Medien, Ressourcen, Kontexten und Lernwegen sollte der Lernende selbst eine Auswahl treffen können.
- Social Interaction (Soziale Interaktion): Auch Möglichkeiten der sozialen Interaktion, z. B. in Form von Gruppendiskussionen, Arbeit in Teams oder Beratung durch Lehrende haben eine wichtige motivationale Funktion.
- Error Tolerance (Fehlertoleranz): Lernende machen Fehler und dies ist ein wichtiger Faktor beim Lernen. Deshalb wird empfohlen, eine "sichere" Lernumgebung zu schaffen, in der keine demoralisierende Bestrafung zu erwarten ist. Dies heißt nicht, dass auf Feedback verzichtet werden soll.
- Measurement (Erfolgsmessung): "It is ironic that while nothing is more motivating in sports and games than scorekeeping, most people don't look forward to being measured while learning.". Empfohlen wird hier ein positives Maß, das weniger an Fehlern als beispielsweise an persönlicher Verbesserung orientiert ist.
- Feedback (Rückmeldungen): Rückmeldungen des Systems sollten begleitend erfolgen und positiv bzw. ermutigend formuliert werden. Spitzer empfiehlt eine Konzentration auf Vorschläge zur Verbesserung statt auf die Fehler.
- Challenge (Herausforderung): Die zu bewältigenden Aufgaben sollten nicht trivial sein, sondern eine hinreichende Herausforderung darstellen. Empfohlen werden besonders durch die Lernenden selbst gesetzte Ziele.
- Recognition (Anerkennung): Die Motivation kann erhöht werden, wenn der Lernfortschritt durch das System, andere Lernende oder Lehrer anerkannt wird.
Vernachlässigt scheinen hier einige Elemente, wie die Relevanz des Themas für den Lernenden im Sinne einer späteren Anwendbarkeit in realen Situationen sowie der Grad der Freiwilligkeit, der die Einstellung zu jeder Bildungsmaßnahme prägt.
Quelle:
Blumstengel, Astrid (1998). Entwicklung hypermedialer
Lernsysteme.
WWW: http://dsor.uni-paderborn.de/de/forschung/publikationen/blumstengel-diss/Motivation.html
(00-11-11)
Literatur:
Spitzer, D.R. (1996). Motivation: The Neglected Factor in
Instructional Design. Educational Technology, 5-6, S. 45-49.
Zusammenhänge zwischen Bewertung und Motivation
Anhand emprischer Untersuchungen der mimischen Motorik (Lächeln) bzw. von Armbewegungen während einer Reizdarbietung entwickelt Neumann (2003) die These, dass es eine enge Wechselwirkung zwischen evaluativen Prozessen und fundamentalen motivationalen Systemen der Annäherung und Vermeidung gibt, welche Emotionen und Einstellungen zugrunde liegen. Diese Wechselwirkung wird durch eine bidirektionale Verknüpfung von evaluativen Prozessen und motivationalen Systemen ermöglicht, sodass die Aktivierung motivationaler Systeme sowohl Ursache als auch Folge affektiver Reaktionen sein kann. Da evaluative Informationen schneller verarbeitet werden als nicht-evaluative Informationen, erfolgt daher die Auswahl kompatibler motivationaler Systeme durch evaluative Prozesse zeitlich bevor langsamere nicht-evaluative Prozesse Einfluss auf die motivationalen Systeme bekommen. Zwar sind auch nicht-evaluative Prozesse bei der Generierung von Emotionen von Bedeutung, denn ein lächelndes Gesicht kann automatisch eine positive affektive Reaktion und die Repräsentation einer Annäherungsbewegung auslösen. Wird jedoch in der hieran anschließenden kognitiven Analyse erkannt, dass die fremde Person über eine Handlung der eigenen Person lacht, so resultiert möglicherweise eher eine aversive Reaktion. Erst die Kombination von evaluativen und kognitiven Prozessen erlaubt es, sich flexibel und kontextsensitiv in einer komplexen Umwelt zu verhalten.
Wie die von Neumann berichteten empirischen Befunde deutlich machen, lassen sich appetitive Bewegungen, wie der mimische Ausdruck des Lächelns oder Armbewegungen in Richtung der eigenen Person, schneller initialisieren, wenn Information positiver Valenz verarbeitet wird. Demgegenüber lassen sich aversive Bewegungen, wie das Zusammenziehen der Augenbrauen oder Armbewegungen weg von der eigenen Person, schneller initialisieren, wenn Information negativer Valenz verarbeitet wird. Die schnellere Initialisierung kompatibler Bewegungen lässt den Schluss zu, dass die entsprechenden motorischen Programme durch die Verarbeitung kompatibler evaluativer Information voraktiviert werden. Dies wird im Rahmen des hier skizzierten Modells auf die automatische Aktivierung des kompatiblen motivationalen Systems durch evaluative Prozesse zuruckgeführt. Vermutlich stützen diese Befunde auch das Konzept des Priming, wonach früher rezipierte Inhalte - in diesem Fall emotionale Bewertungen - nur vorbewußt bleiben, also nicht aktiv abgerufen werden können, jedoch später mit einem ähnlichen Reiz konfrontiert, wieder in den Sinn kommen bzw. wirksam werden.
Insgesamt skizziert Neumann damit ein Modell, wonach die Auslösung von Emotionen und der beteiligten Reaktionstendenzen eine Funktion von sukzessiven Schritten der Informationsverarbeitung ist. Annäherungs- und Vermeidungstendenzen werden in einem ersten Schritt automatisch durch evaluative Prozesse aktiviert. In weiteren Schritten der Informationsverarbeitung werden neben der Valenz schließlich wichtige Kontextinformationen einbezogen. Dadurch entstehen unterschiedliche diskrete Emotionen, und die motivationale Ausrichtung kann in bestimmten Fällen auch umgekehrt werden.
An einem praktischen Beispiel betrachtet könnte das bedeuten, dass bei Lernvorgängen in der Schule eine "aus dem Bauch kommende" positive oder negative Bewertung des bevorstehenden Unterrichts bzw. Lernstoffes schon vor dem kognitiven Aufbau einer minimalen Motivation wirksam wird bzw. mit dieser in fördernder oder störender Wechselwirkung steht.
Die wechselseitige Verknüpfung von evaluativen Prozessen und motivationalen Systemen bringt mit sich, dass affektive und motorische Repräsentationen immer in sehr kurzer Folge hintereinander aktiviert werden. Dies erlaubt nicht nur eine schnelle Koordination des Verhaltens mit den Erfordernissen der Umwelt, sondern stabilisiert einmal aktivierte Zustände, sodass diese nur mit einem gewissen kognitiven Aufwand verändert werden können. Schon LeDoux (1996) beobachtete eine automatisch auf kurzem Wege laufende Reaktion bei der Verarbeitung bedrohlicher Reize direkt an die Amygdala, um eine Fluchtbewegung auszulösen.
Neumanns Ergebnisse stützen damit auch den von Antonio R. Damasio (1999) konstatierten "Body-Loop", der eine bidirektionale Verknüpfung von motivationalen Systemen und evaluativen Prozessen auf neurophysiologischer Basis nachgewiesen hatte. Dass basale motivationale Systeme mit den evaluativen Prozessen direkt verknüpft sind, zeigt, dass die Informationsverarbeitung des Menschen offenbar auf grundlegende Erfordernisse und Beschaffenheiten der Umwelt bereits vorbereitet ist. Evolutionspsychologisch betrachtet hat sich die Verknüpfung von motivationalen Systemen und evaluativen Prozessen im Laufe der Evolution vermutlich deshalb herausgebildet, um möglichst schnell auf Situationen reagieren zu konnen, die ein rasches Handeln erfordern.
Auch kann zu dem hier beschriebenen Phänomen eine Ähnlichkeit der Intuition gesehen werden, mit der ein spontaner Einfall, eine Idee oder auch ein Entschluss beschrieben wird, die plötzlich da sind, ohne dass wir wissen, woher sie kamen. Intuition ist oft wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Das Wesen der Intuition wurde von der empirischen Psychologie bisher kaum erforscht, was daran liegen dürfte, dass Experimente dazu nicht einfach zu realisiseren sind, denn schließlich kann man Probanden nicht anweisen, sich intuitiv zu verhalten.
Quelle:
Neumann, Roland (2003). Bewerten und Verhalen: Die Rolle der
Motorik in Einstellungen und Emotiomnen. Psychologische
Rundschau 54 (3), S. 157-166.
Literatur:
LeDoux, Joseph (1996). The emotional brain, The mysterious
underpinnings of emotional life. New York: Simon &
Schuster.
Damasio, Antonio (1999). The feeling of what happens: Body
and emotion in in the making of consciousness. London:
Heinemann.
Motivation als Erklärung für menschliches Verhalten: Kelleys Attributionswürfel-Modell zur Ursachenerklärung von Verhalten
Nach Kelley wird die Ursache für ein beobachtetes Verhalten jener Bedingungen zugeschrieben, mit der es über die Zeit gemeinsam variiert. Das Modell von Harold Kelley (1972) zeigt, wie Menschen als Laien und auch als Wissenschaftler vorgehen, wenn sie wissen wollen, inwieweit ein Verhalten eher Personen- oder Situationsfaktoren zugeschrieben werden kann. Kelley unterscheidet zwischen drei Beurteilungsdimensionen für die Erklärung von Verhalten: Konsens, Distinktheit, und Konsistenz.
- Konsens: Vergleich mit anderen Personen auf Übereinstimmung des Handelns (individuelle Unterschiede).
Je weniger unter gleichen Situationsanlässen das Handeln einer Person mit dem Handeln der Mehrheit anderer Personen übereinstimmt, desto mehr scheint es von individuellen Personfaktoren bestimmt zu sein. Beispiel: Eine Menschenmenge steht tatenlos um das Unfallopfer. Nur einer kniet nieder, um zu helfen. Er muss sehr »hilfsbereit« sein. Umgekehrt: Je mehr das Handeln einer Person mit dem Handeln der Mehrheit anderer Per sonen übereinstimmt, desto weniger wird es wohl von Personfaktoren und womöglich eher von starken Situationsfaktoren bestimmt.
Beispiel: Wenn ein Student jede Woche wieder an einer Pflichtveranstaltung teilnimmt und dies auch alle anderen Studenten tun, sehen wir keinen Anlass, für dieses Verhalten eine besondere Personeigenschaft verantwortlich zu machen. Das Verhalten erscheint vielmehr durch die Situation, nämlich durch den Pflichtcharakter der Veranstaltung, veranlasst zu sein. - Distinktheit: Vergleich mit
anderen Situationsanlässen auf Übereinstimmung des Handelns
(intraindividuelle Unterschiede über Situationen hinweg).
Je mehr eine Person unter verschiedenen Situationsanlässen gleich handelt, desto mehr scheint ihr Handeln von individuellen Personfaktoren bestimmt zu sein. Beispiel: Jemand ist nicht nur am Arbeitsplatz von seinen beruf lichen Aufgaben erfüllt, er spricht darüber auch während des Betriebsausflugs und verwandelt jedes gesellige Zusammensein in eine Arbeitssitzung. Er muss sehr »leistungsmotiviert« sein. Umgekehrt: Je mehr eine Person unter verschiedenen Situationsanlässen verschieden handelt, desto mehr scheint ihr Handeln von Situationseinflüssen bestimmt zu sein.
Beispiel: Jemand schwindelt bei einer Klausur, die in einem großen Hörsaal und unter geringer Aufsicht stattfindet, aber nicht beim Kartenspiel mit Freunden. Bei der Klausur hofft die Person wohl, beim Mogeln nicht erwischt zu werden, während das Risiko, von den Freunden als Falschspieler entlarvt zu werden, größer erscheint. - Konsistenz:
Vergleich mit früherem Verhalten auf Übereinstimmung des Handelns
(Stabilität oder intraindividuelle Unterschiede über die Zeit hinweg)
Verhält sich eine Person über die Zeit hinweg immer ähnlich, so liegt es nahe, ihr Verhalten auf individuelle Person faktoren zurückzuführen. Beispiel: Ein Kind, das sich schon im Kindergarten immer besonders angestrengt hat, um schwierige Aufgaben zu lösen, legt nach der Einschulung großen Eifer an den Tag, um das Lesen zu lernen. Das Kind muss wohl stark und dauerhaft »leistungsmotiviert« sein. Umgekehrt: Wenn sich eine Person über die Zeit hinweg unterschiedlich verhält, liegt es nahe, ihr Verhalten auf die Unterschiedlichkeit von Situationsfaktoren zurückzuführen.
Beispiel: Ein Kind, das sich im Kindergarten immer besonders schwierige Aufgaben ausgesucht hat und diese mit großem Einsatz zu lösen versucht hat, zeigt nach der Einschulung bei den vom Lehrer gestellten Aufgaben Desinteresse und Langeweile. Die vom Lehrer gestellten Aufgaben sind offenbar zu einfach.
(Heckhausen & Heckhausen, 2006).
Literatur
Kelley, H. H. (1972). Attribution in social interaction. In E. E. Jones, D. E. Kanouse, H. H. Kelley, R. E. Nisbett, S. Valins and B. Weiner (eds.), Attribution: Perceiving the causes of behavior (pp. 1-26), Morristown, NJ: General Learning Press.
Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2006). Motivation und Handeln: Einführung und Überblick. Springer, Berlin.
Soziale Motive nicht nur an Personen gebunden
Soziale Motive sind beim Menschen in viel stärkerem Ausmaß als bei Säugetieren nicht mehr nur auf Artgenossen beschränkt, sondern richten sich aufgrund der anderen Art der Wahrnehmung der Umwelt auch auf "nicht-soziale" Objekte. Am Beispiel des Sicherheitsmotivs soll das etwas erläutert werden.
Bei sozialen Säugetieren regelt der Sollwert Abhängigkeit den Umgang mit vertrauten Artgenossen zwischen den Polen Bindung und Überdruss. Auch bei den Menschen wird dieses Verhalten durch dieses Motiv gesteuert, doch sind wir der Meinung, dass darüberhinaus das Sicherheitsmotiv generell den Umgang mit dem Vertrauten beeinflusst: Sicherheit zu spenden vermag nicht mehr nur der vertraute Artgenosse, sondern auch vertraute Objekte, Gegenden und Situationen, ja sogar so abstrakte Dinge wie vertraute Denkschemata, Weltanschauungen und Überzeugungen werden zu potentiellen Sicherheitsquellen.
Damit kann die ganze Umwelt zum Sozialpartner des Menschen werden, indem jedem Reiz ein Vertrautheits- und ein Fremdheitswert zugewiesen wird. Trotz all dem ist nicht anzunehmen, daatkindie Motive ihre Herkunft vollständig leugnen können: Nicht alles wird in der Lage sein, die Motive in gleicher Weise anzusprechen. Artgenossen werden im Allgemeinen immer noch die relevantesten Objekte für die soziale Motivation sein. Man muatkinhier wohl auch mit interindividuellen Unterschieden, z.B. aufgrund unterschiedlicher Sozialisation, rechnen.
Quelle: http://www.motivations-psychologie.ch/FignerGrasmueck_Liz.pdf
Weitere Quellen & Literatur
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::
